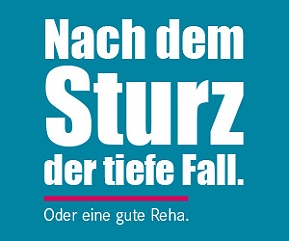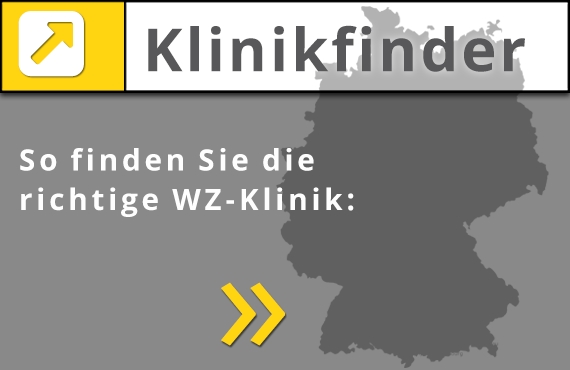Im Folgenden finden Sie aktuelle Pressemitteilungen und Artikel über uns aus den letzten sechs Monaten auf einen Blick. Falls Sie Fragen haben oder Termine für Interviews vereinbaren möchten, stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bestmöglich.
Veröffentlicht am: / News-Bereich: